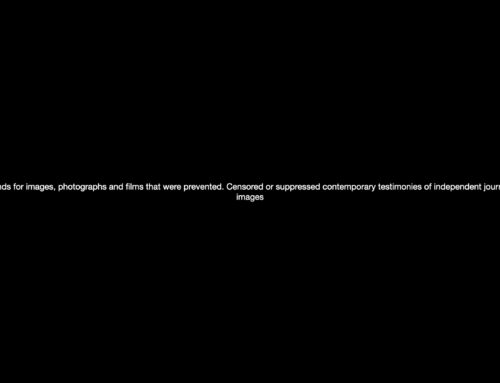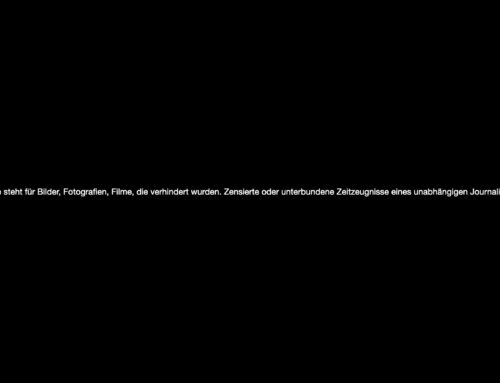schrit_tmacher Festival 2025 in Heerlen
Mehr nicht
Tanz und Musik reichen einander die Hände, ohne sie zu drücken: Auf sättigende Weise luftig zeigte sich der „Garden in the Sky“ des Japaners Saburo Teshigawara im Theater Heerlen, eine Aufführung mit dem Cellisten Jonathan Roozeman und der Tänzerin Rihoko Sato
von Melanie Suchy
Zwischen Himmel und Erde oder Wipfel und Wurzel, Luft und Boden. Die Distanzen, mal Nähe. Nahsein eher als Möglichkeit denn als Tatsache. Was sind die da? Etwas ist immer präsent: der Cellist, sein Cello und sein Stuhl. Und 15 weitere Stühle in Reihe, einige links, einige rechts von ihm, der Leere der Bühne zugewandt. Ihrer Theaterfülle. Die korrekte Linie, Stuhl, Abstand, Stuhl – sachliches Design, harte Lehnen, deren Schwarz im Licht manchmal grau schimmert – riegelt den Raum ab, nein nicht ganz. Sie haben Luft nach hinten. Nach unten, unter sich und auf sich. Der Cellist setzt sich in einer kurzen Dunkelpause mal um. Als sei der ganze Raum samt ihm ein paar Zentimeter verschoben worden. Zuweilen sind die Stühle weg, weil sich Schatten auf sie setzt. Kein-Licht. Mit Licht wirken sie stumm. Halten die Ohren auf. Bis auf einmal die Tänzerin einen Fuß auf eine der Sitzflächen stellt, das andere Bein hochzieht, hockt, über der Erde, sich dann auffaltet und in die Höhe reckt. Zum Himmel? Bevor man hier, ziemlich nah am Cellisten, ein bisschen Wald wittert, ist sie schon wieder unten. Gesunken. Sie belegt zwei Stühle. Eine Hand fällt langsam zu Boden.
Dieser „Garden in the Sky“ wird denen, die im großen Theater in Heerlen dabei waren – es war gut gefüllt, nicht ausverkauft – in Erinnerung bleiben in seiner beredten Kargheit. Feinste Musik eines einzigen Instrumentes, ohne Elektronik; dazu, damit, daneben, davor eine Tänzerin und ein Tänzer. Ihr Tanz. Mehr nicht. Das war stimmig. Das Gegenteil von Sensation, Spaß und Aufregung.
Aus Holz
Die kleinen Kicks, die so ein Abend braucht als visuelle Auflockerung, brachte Saburo Teshigawara als Tänzer ein, im bodenlangen Gewand und mit offenem Gesicht. Stellenweise tauchte er auf und schien dem schon Vorhandenen, dem schwerelosen, in Tonfolgen und Körperkurven schwebenden Zwiegespräch, -gesang, -gefliege der Kollegen, kurze Zaunpfähle einzurammen, die Blümchen zu köpfen, Strünke zu spalten, lose Blätter aufzuwirbeln. Schmückender Stein zu sein. Teshigawara gab so das Konkrete, er ging, kippte um, lag auf der Seite, stand, drehte sich flott um die Achse, zerschnitt Luft, ordnete im Stehen den rechten Arm waagerecht zur Seite und ein einziges mal beide Arme, symmetrisch wie ein großes Zeichen. Nur so.
Zum wunderlichen Gelände wurde dieser „Garden in the Sky“. Es ging: um Kunst. Um drei Menschen, die miteinander Kunst machen, in dem einen Moment, genau diesen 55 Minuten an dieser Stelle. Mit drei Komponisten im zeitlichen Hintergrund, Johann Sebastian Bach, Gaspar Cassado, Zoltán Kodály. Plus 16 Stühlen. Das Licht wechselte weich, kam von den Seiten, mal breit, mal schmal, oder von oben, gab frei, gab Gelb, oder machte sich klein und pointierte. Teshigawara war hier als erfahrener Inszenator am Werk. Der Choreograph, Tänzer, Regisseur, Jahrgang 1953, ist schon lange in Europa ein geschätzter Gastkünstler. Einst lud ihn William Forsythe, Ballettintendant in Frankfurt am Main, ein, erst kürzlich, 2024, schuf er am Theater Basel ein Stück für das Ensemble, das sich zeitgenössischem Tanz widmet. Bei der Ruhrtriennale 2014 tanzten Teshigawara und Sato auf knirschendem, glitzerndem Glas.
Aus Sand
So rot wie das Blut an einer von Satos Händen damals ist das lange Kleid-Gewand, das sie hier im zweiten Teil trägt, hochgeschlossen und langärmlig. Sie wirkt nun schwerer, beengter, und das Fließen ihres Tanzes, der Arme, Schulter, Kopf, betont, getragen von stabil nachgebenden Beinen, im Wogen von rechts nach links nach rechts, wird zu gleichförmig.
Zu Beginn hatte sie noch, in Hose und Hemdchen, Magie hergestellt, indem die langsam in alle Richtungen wellenden Arme und ihr biegender Körper eine eigene Musik verströmten. Sie knetete sachte am Zeitfluss. Parallelisierte die Musik, ohne ihr zu folgen. Beide horchten und gehorchten auf ihre Weise dem, was da entstand: die Tänzerin und der Musiker. Der 27-jährige Jonathan Roozeman spielte die Cello-Suiten Nr. 2, 5 und 6 von Bach, als lausche er sie der Stille ab. Ganz leise strich er mitunter, Klänge wie Dämmerlicht, knapp an der Dunkelheit. Um dann wieder, mit entschiedenem Druck, Sohlen auf Erde zu setzen. Ohne süffig zu werden. So musizierte er auch die folgenden Stücke, hörbar verwandt mit den Barockmeisterwerken. Zeitweise war hier mehr Erregung, andere Tonarten wehten herbei, Folkloretanzrhythmen, oder das Cello tastete, vermehrte Stimmen und sammelte Melodiefragmente ein.
Aus Atem
Diese Wanderschaften, auch Verstreutheiten, waren in Teshigawaras Tanz wiederzuerkennen, der auch mal ruckte, anhielt, Hände spreizte oder plötzlich am gestreckten Arm erschlaffen ließ. Einen Hauch Humor verlieh er dieser Unvorhersehbarkeit, die in Zoltán Kodálys Cello-Sonate op. 8 von 1915 und Gaspar Cassadós Suite für Violoncello solo von 1926 vielleicht ernster grundiert war.
Von „Harmonisieren“ sprach der Choreograph im anschließenden Publikums-Talk; und auf die Frage nach Berührung erläuterten er und Kollegin Sato, dass sie Distanzen schätzen. Würden sie einander beim Duett tatsächlich berühren, käme dies als zu bedeutsam rüber, zu konkret. „Nur, wenn es wirklich nötig ist“, sagte Sato. So ehrten sie, bei aller Nähe, eben den Abstand: zum Musiker, zu den Klängen, zueinander. Bepflanzten die Bühne mit den Tanzblumen, die ihre eigene Zeit haben. Keine. Oder alle, für immer. Obwohl Teshigawara den poetischen Garten-im-Himmel-Titel herunterspielte: Garten sei doch einfach was Schönes, und nach genügend langer Zeit auf der Erde wünsche er sich in den Himmel, und überhaupt, das alles solle bitte gar nichts bedeuten. „No meaning“.