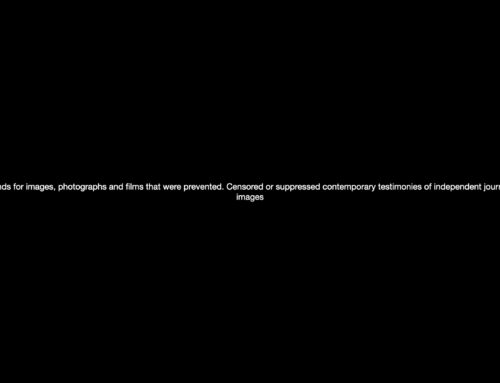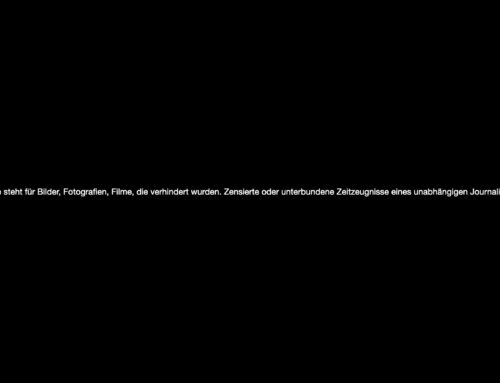Tanztheater Wuppertal Pina Bausch Wiederaufnahme
Die Sieben Todsünden Heute?
Standing Ovations bei der Wiederaufnahme 2025 im Wuppertaler Opernhaus. Das Publikum feiert Ute Lemper und das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch (ohne Zusätze) für die Wiederaufnahme der „Sieben Todsünden“ das vor beinahe fünfzig Jahren uraufgeführt wurde.
Gedanken von Klaus Dilger
Standing Ovations! „Was denn sonst?“, fragt sich der Besucher, der dieses Tanztheater Wuppertal Ritual am Ende einer Aufführung schon des öfteren erleben durfte. Eine Aufführung ohne „standing ovations“ ist in Wuppertal kaum denkbar und zöge ganz unmittelbar eine Endzeit-Diskussion nach sich.
Dass es auch Heuer diese „ovations“ gab, ist deshalb eigentlich nicht (mehr) der Rede wert und findet doch immer noch Erwähnung in den Medien.
WERK UND BESETZUNG
Während weitgehend Konsens darüber herrscht, dass die Werke von Pina Bausch längst bewiesen haben, dass sie zeitlos relevant sind, zumindest in ihrer überwiegenden Mehrheit, taucht in schöner Regelmäßigkeit die Frage auf: Waren die aktuellen Interpretinnen und Interpreten der Stücke in der Lage, das jeweilige Werk (und welche Version davon?) adäquat auf die Bühne zu bringen?
Für die Tänzerinnen und Tänzer, die Heute die Aufgabe haben, bereits getanzte Rollen (auch anderer Choreograf_innen) irgendwo in der Welt zu übernehmen oder einstudieren, ist längst das Video die Basis geworden, aus der sie, zusammen mit den jeweils individuell erprobten Methoden eines erfolgreichen Re-Enactments, ihre ganz persönliche Rollenaneignung betreiben. Wie geht die jeweilige Probeleitung der Pina Bausch Stücke heute mit dieser Tatsache um? – Was ist letztlich das Werk der Choreografin, was das der ursprünglichen Besetzungen ?
Die entscheidende Frage hierbei, zumindest für den Schreiber dieser Zeilen: hat dieses Werk in der jeweils aktuellen Inszenierung noch einen authentischen Fingerabdruck durch eine ebensolche Interpretation eines neuen oder alten (Interpreten)Personals?
DIE SIEBEN TODSÜNDEN 2025
Am Premieren-Wochenende feierten „Die Sieben Todsünden“ von Pina Bausch, basierend auf Berthold Brechts Text und Kurt Weills Musik, die x-te Wiederaufnahme und die Dritte, die der Rezensent dokumentieren durfte.
Worum es geht, formulierte Melanie Suchy vor einigen Jahren auf TANZweb so:
„… In den „Sieben Todsünden“ ziehen zwei Schwestern namens Anna durch sieben Städte Amerikas, um Geld für eine kleines Haus für die Familie, für Eltern und Brüder, zu verdienen. Anna I, die Praktische, organisiert, wie Anna II, „meine Schwester ist etwas verrückt“, die Tänzerin, sich selbst zu Markte trägt. Das berichtet Ute Lemper im züchtig schwarzen Kostüm, singend, während sie die Schwester im Blumenkleidchen, Stephanie Troyak, mit Kamm, Bluse, Rock und Schuhen ausstaffiert, dressiert und einen Scheinwerfer auf sie richtet. Für das naive oder träumende Mädchen ist er Sonnenschein, und derart verblendet läuft sie in ihr Verderben, von Station zu Station, von „Sünde“ zu „Sünde“. Posiert erst erschreckt, dann lustvoll für einen Photographen, lüpft den Rock, lässt sich von Männern antatschen, tanzt im fleischfarbenen Unterkleid im Schwarm anderer knapp gekleideter, halbseidener Damen, wird von einem Zuhälter wie Ware mit Maßband gemessen, verliebt sich in einen jungen Fernando, aber ihre zielorientierte Schwester zerschlägt die Verbindung der Hände. Endet müde, den Blick zu Boden gerichtet, wie ihr ehemaliger Sonnenscheinwerfer.
„Wir alle sind frei geboren“, singt Anna I Brechts Text zu einem Marschrhythmus, wie zum Hohn, als das Frauenvölkchen in engen schwarzen Röcken erscheint, die Arme an die Oberkörper geklemmt. Immerhin haken sie einander ein, doch nicht für die Revolution, sondern sie schwingen für eine freudlose Show die Beine hoch. Das alles ist bitter, furchtbar, eine moralisierende Leidensgeschichte, in die sich Stephanie Troyak, gekonnt hineinbegibt, mit allem Bausch-Schwanken in den Gesten, Blicken und Tänzen zwischen schwungvoller Aktivität und schlaffer Passivität. Doch so total, wie es einst Jo Ann Endicott tat und in ihrem ersten biographischen Buch beschreibt, verschmilzt die junge Amerikanerin nicht mit der Rolle, sie zieht auch die Zuschauer nicht derart stark mit in den Abstieg, die Unterwerfung, den Verlust der Brechtschen Todsünden, sprich Tugenden, wie „Stolz auf das Beste des Ichs“, „Zorn über die Gemeinheit“, „selbstlose Liebe“ oder „Neid auf die Glücklichen“. So sieht man einer kruden Geschichte Jahrgang 1933 zu – und dem Werk einer Choreographin, die ab hier ihre Arbeitsweise ändern und das Genre Tanztheater neu erfinden wird.
Denn das Thema sowohl der Unterhaltungstanzrevue als auch deren Collagen-Struktur, wie Pina Bausch sie im zweiten Teil des Abends, „Fürchtet euch nicht“, noch ausführlicher vorführt, wird dann zum Grundelement ihrer späteren Stückentwicklungen. Das Wuppertaler Sinfonieorchester unter der beherzten Leitung von Jan Michael Horstmann spielt weiterhin auf der hinteren Bühne, aus der Tiefe des Raumes heraus schmettern und säuseln die Musiker Songs aus der „Dreigroschenoper“, aus „Happy End“, dem „Berliner Requiem“, dem „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“. …
„… Wer sich nicht fürchtet, schläft. Wer tanzt, wie diese seltsame stark geschminkte Truppe hier aus Männern und Frauen in Strapsen, Bustiers, schwarzen, knallbunten und mattfarbenen Kleidern, Röcken, federgesäumten Wallemänteln, der tanzt sich vielleicht die Furcht aus dem Leib, mit Armschwung, Beinwurf, wedelndem Unterschenkel oder nach vorn fallenden Tippelschritten. Macht sich blind. Aber wird gesehen. Das sind Gefühle, Fluchten und Fragen, die in den Stücken von Pina Bausch immer wiederkehren. Im Grunde sind sie nicht veraltet, sondern unentrinnbar, solange man lebt und solange Menschen auf Bühnen sich anderen zeigen. Deshalb ist dieser Tanzabend auch sehenswert, weil man erkennt, wie sie mit dem musikalisch-dichterischen Blick auf die Zwanzigerjahre Themen für ihre Gegenwart fand. Die „Todsünden“ haben tolle Momente, aber vielleicht doch nicht, aus praktisch-tänzerischen Gründen, sieben Leben….“
… und da sind seither schon wieder sieben Jahre vergangen und einige Interpreten sind neu hinzugekommen.
Nicht alle Abgänge in der Compagnie wurden seither und speziell in den letzten Jahren adäquat gut ersetzt, manche schon. Doch nie im Hinblick auf ein Mehrgenerationen-Ensemble, für das das Tanztheater eigentlich weltberühmt geworden ist oder sein könnte. Was besagt das?
Geschichte und erlebter Kontext
Zeitzeugen mögen sich erinnern: Deutschland erlebte zur Zeit der Entstehung der „Sieben Todsünden“ von Pina Bausch, Mitte Ende der Siebziger-Jahre, dass ehemalige Nazi-Grössen oder -Helfer noch immer in bedeutenden Positionen die Zukunft eines Landes mitbestimmen durften, dessen Recht hierauf, auf Grund der GREUEL DES ZWEITEN WELTKRIEGES weltweit lange diskutiert worden war. In diesem, 1976 noch immer gültigen Kontext, als Pina Bausch ihre Sieben Todsünden in Wuppertal schuf, gab es der Wegschauenden Viele, und Heute?
Pina Bauschs Ensemble schaute in 1976 dieser Gesellschaft, auch wenn sie ihre künstlerische Freiheit eben diesen Bürgerlichen verdankte, mitten ins Gesicht, jeden Abend, jede Aufführung.
Welche Wucht so etwas entfalten kann, davon durften sich die Zuschauenden bei „Kontakthof – Echoes of ‚79“ unlängst durch die eingespielten Zeitdokumente der Tanzenden überzeugen.
Bertolt Brechts Stück, in dem Bettler, Huren und Räuber auftreten, stellt die dunkle, kriminelle Seite der großstädtischen Welt dar. Er kritisiert in der „Dreigroschenoper“ mit Satire und Spott die bürgerlich-kapitalistische Welt der Weimarer Republik, quasi am Vorabend des Zweiten Weltkriegs.
Das sind auch die Dimensionen, die vermittelt werden wollen: heutigen Zuschauenden und heutigen Tanzenden, die diesen Kontext nicht selbst erlebt haben, um ein Stück aus dieser Epoche authentisch glaubhaft auf die Bühne zu bringen.
Nicht restlos überzeugend…
2018 und 2020, trotz (vielleicht auch wegen) der katastrophalen Auswirkungen von Maßnahmen zur Corona-Pandemie, gelang dies noch hervorragend.
Am Wochenende der Wiederaufnahme 2025, gelang dies nicht überzeugend, trotz Ute Lemper, trotz Stephanie Troyak, trotz Melissa Madden Gray, die ihre Leistung von 2018 und 2020 fast nahtlos abrufen konnten. Emily Castelli verkörperte die Rolle des beinahe noch kindlich jungen Mädchens, das offensichtlich missbraucht wird, während alle anderen wegschauen, glaubhaft und ausdrucksstark, trotz imposanter Vorgängerinnen in dieser Rolle, wie Ditta Miranda und Tsai-Wei Tien. Und Steffen Laube überzeugte erneut in der äusserst undankbaren Rolle als fieser Kinderschänder, während alle anderen Männerrollen den Schutz der holzschnittartigen Bewegungsensembles erfahren, die ihnen Pina Bausch durch ihre Choreografie gewährt hatte, um sich distanzieren zu können.
Vielleicht hätte am Premierenabend, um zu einem überzeugenden Gesamterlebnis zu kommen, auch das Orchester noch mehr die Balance finden müssen, zwischen dem Raum, den Ute Lemper braucht, um ihren Gesang entfalten zu können und der Wucht, die das Ensemble braucht, um überzeugend tanzen zu können.
Feinabstimmung kann sich entwickeln, Vielleicht haben dies bereits die nachfolgenden Aufführungen gezeigt? Fehlbesetzungen jedoch, die durchaus sichtbar wurden, können nur korrigiert werden, wenn sie denn ernsthaft hinterfragt würden.