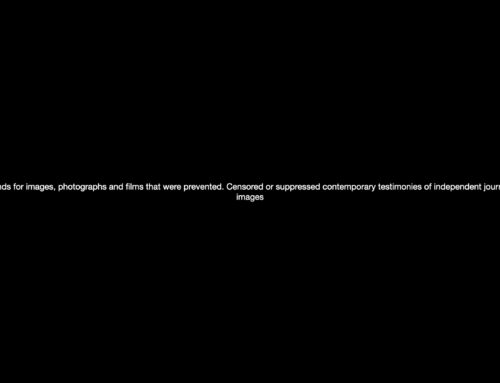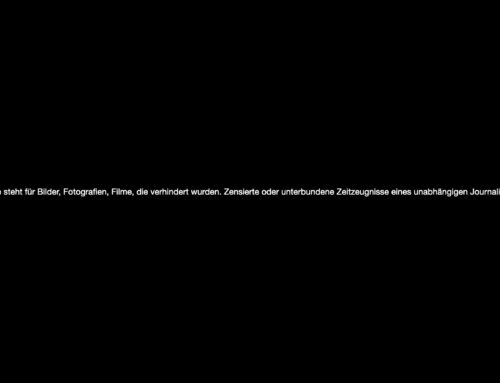Luft anhalten – Ein bildgewaltiges Tanzereignis – TEN CHI im Wuppertaler Opernhaus soeben zu Ende gegangen
Eine Nachtkritik von Melanie Suchy
2004 ist das Stück entstanden und nach 2012, als diese Kreation von Pina Bausch letztmals in London zu sehen war, tanzte nun, bis auf wenige Ausnahmen, die Originalbesetzung dieses humorvolle und ungewöhnlich leichte Werk der genialen Tanzschöpferin in der Heimatstadt des Wuppertaler Tanztheaters vor begeisterter und längst ausverkaufter Kulisse.
Die bejubelte Wiederaufnahme von „Ten Chi“ des Wuppertaler Tanztheaters Pina Bausch
ZU DEN VIDEOIMRESSIONEN
Weiß auf Schwarz, sie fallen und fallen und fallen. Schneeflocken, Himmelsblüten. Herab, herab, während die dunkle Walschwanzflosse aus dem Boden nach oben ragt. Wie inmitten einer Bewegung erstarrt, mit einem leichten Schwung in der waagerecht fliegenden Doppelflosse, so dass dies auch Stamm und Krone eines stilisierten Baumes sein könnte. „Ten Chi“ ist das Japan-Stück von Pina Bausch, das 2004 im Schauspielhaus Wuppertal Premiere hatte. Mit diesem Bühnenbild von Peter Pabst, das Luft und Wasser kombiniert, Schwere und Leichtigkeit, verführt es das Auge fast zu sehr. Gemeinsam mit einem Walrückenhügelchen weiter hinten auf der Bühne, bildet der imposante Körperteil im zunächst mondkühlen Licht eine offene Landschaft mit vorn und hinten, Nähe und Ferne, in der die Tänzer manchmal wie beschirmt oder gerahmt von einem riesigen kalligraphierten Zeichen wirken. Das sie übrigens auch nie berühren. Wie schön. Und welcher Zuschauer hebt nicht ab und an die Augen über das bodennahe Geschehen hinaus und versenkt sich in das friedliche Flockenblütengestöber, das mal dichter, mal loser ist, aus unendlich vielen Bewegungen besteht, einem Flirren, Taumeln, Schweben, Sinken, Stürzen, man verliert so angenehm den Halt, lässt das Denken los. Leere.

Vielleicht ist das eines der Japan-Themen, die als Mitbringsel der mehrwöchigen Recherchereise mit dem Ensemble in das Stück gefüttert wurden. Es ist zwar ein Klischee, doch immerhin ein künstlerisch interessantes. Auch der Wal ist ja eines, als schwimmende Delikatesse; so dass diese Flosse das Denkmal einer bedrohten Art sein könnte. Oder ein Wegweiser zum Tod. Die Katastrophe von Fukushima passierte später. „Ten Chi“ weiß nichts davon, das kann man dem Stück nicht vorwerfen. Aber manche der gespielten kurzen Szenen, die sich auf angeblich Typisches oder in Japan Erlebtes beziehen, wirken noch alberner mit ihrem gespielt naiven Ton als früher. Doch es gibt auch großartige Szenen. Einige der Tanzsolos gehören dazu. Überhaupt besteht das ganze Stück aus auffällig vielen Solos, dazu ein paar Zweiermomente; aber im Grunde flocken hier die Menschen wie die fallenden Blüten alleine vor sich hin. Herab.

Untergang
Natürlich sind auch die Kostüme Hingucker. Die sieben Männer allerdings bleiben in ihrer schwarz-weißen Anzug-Uniform, nur Dominique Mercy erscheint auch einmal im Kleid mit Ausschnitt und einmal in seidenen Hausmänteln, die er in farbigen Schichten übereinander trägt und die ihm ein junger Tänzer sorgfältig abschält, bis er auch ihn schwarz uniformieren kann. Zeichen der Zeit. Die Frauen hingegen tragen bodenlange Kleider, die seidenmatt glänzen oder wirken wie aus leichtem Samt. Sie fallen, sie fließen an den Tänzerinnen herab, manche sind sogar länger, so dass ihr Saum als Lache am Boden liegt. Eine Verwandtschaft mit den Fischen wird erkennbar. Lauter Undinen. Die Stoffe lassen sie erblühen in der dunkel grundierten Landschaft, in Hellrot, Orange, Violett, aber auch in Weiß und Schwarz. Diese Schönheit trägt zur Verführung von „Ten Chi“ bei, ist aber auch eine Art Zwang, dem diese zehn Frauen Genüge tun. Ihr unterschiedlicher Umgang damit wird nicht groß herausgestellt. Doch drei Solos deuten ihn an. Ditta Miranda Jasjfi tanzt das Blütenblättrige, schnell, mit zwirbelnden Handgelenken, die Arme und den Körper zu Linien und Winkeln gestreckt und gefaltet, leichtfüßig sprudelnd, wie ein Buchstabenliedchen in einer unbekannten Sprache mit hellem Klang.

Asuza Seyama hingegen, die Japanerin im Ensemble, tanzt ein Solo, in dem sie sich zu verbergen scheint. Ein fast wildes großes Flattern, bei dem man nie ihr Gesicht sieht. Eine heimliche Verzweiflung, verbotenes Aufbäumen. Schließlich Julie Anne Stanzak, die gegen Ende von hinten auftaucht und nur den Kopf neigt, rechts, links, rechts, und mit dieser ruhigen winzigen Geste den Raum füllt mit einem Schwanken. Ihr Tanzsolo ist betont unspektakulär, kein großes Ausgreifen, Aufreißen, Hinfliegen, Bögenzeichnen, Fingerformen, was andere machen. Sondern eine Walseele, die jemand verschluckt hat. Etwas von tief unten, nicht fremd, aber riesig in der Welle, die es schlägt. Wenn man es fühlen kann.

Rauschen im Universum
Es stimmt ja nicht, wie einige Kritiker bemängelten, auch bei der letzten Wiederaufnahme, die in 2012 unter anderem in London gezeigt wurde, dass „Ten Chi“ nur hübsch anzusehen sei, und den vom Wal behaupteten Tiefgang vermissen lasse. Die Traurigkeit – ob die einen japanischen Klang hat oder nicht, ist egal – weiß nur nicht, wohin mit sich: zwischen Publikumsbonbonszenen, wie der einer Reiseleiterin, Helena Pikon, die sich bei wiederholten Misserfolg ihrer Ansage, „we go now“ in höflichen Floskeln verheddert; Asuza Seyama, die dem kindlichen Springball Ditta Miranda Jasjfi die Knie beim Sitzen zusammenschiebt, einer Stirnbanddemonstration, mehreren Frau-Mann-Zähmungsgesten mit Kehrschaufel und Felldecke, Barfußschritten auf Glas, Gerenne, Zuschaueranimation mit „Können Sie schnarchen?“, Godzillamonsterimitation mit Röchelgeräuschen zu jedem schweren Schritt und Tritt in ein Kopfkissen und flotten bodennahen Männersolos. Dominique Mercy aber hascht in seinem Solo nach etwas, das nicht da ist. Nicht mehr. Immer wieder, mit Schwung, ins Leere. Als verlöre er allmählich auch sich selbst dabei. Und ganz am Rand bückt er sich einmal, so dass die Frau neben ihm sich auf seinen Rücken kringeln kann, die er zwei Schritte trägt, bis sie fließend die Rollen tauschen: tragen, getragenwerden. Es ist die eigene Tochter, Thusnelda Mercy.

Es könnte auch jemand anderes „Tochter“ sein oder „Vater“. Doch in vielen Momenten stellt auch dieses Stück die Frage nach der Besetzung. Es tanzt ja die Originalbesetzung, nur zwei Männer-Parts sind durch die Wuppertaler Neuzugänge Jonathan Fredrickson und Douglas Letheren ersetzt. Sie machen das mit Verve, aber es sind nicht die Szenen, die das Stück tragen oder unter Wasser singen lassen. Eine spezielle Rolle hat auch Mechthild Großmann in „Ten Chi“. Meist in bodenlanges Schwarz gekleidet, taucht sie immer wieder auf (der Ausdruck passt) mit majestätischer Haltung, und spricht mit ihrer tiefen Stimme, die zwischen weich und rotzig moduliert, seltsame Schriftstellertexte über Sex und Liebe und einen neu entdeckten Stern im unmäßig großen und unverständlich geordneten Universum, der „mir persönlich“ bislang nicht gefehlt habe. Sie aber würde dem Stück fehlen. Dieser lange übersehene, überflüssige Stern blinkt im Zuschauerinnenhirn weiter und hält manchmal dieses Stück aus dem fernen Osten zusammen, der mit seiner Ferne hadert – mit seiner Nähe. Diese Ratlosigkeit ahnt man in den nach oben gerichteten Köpfen der Tänzer, die etwas zu erhoffen scheinen. Ewig rieselt der Blütenschnee. Wann ist dann die Zeit der Kirschen?